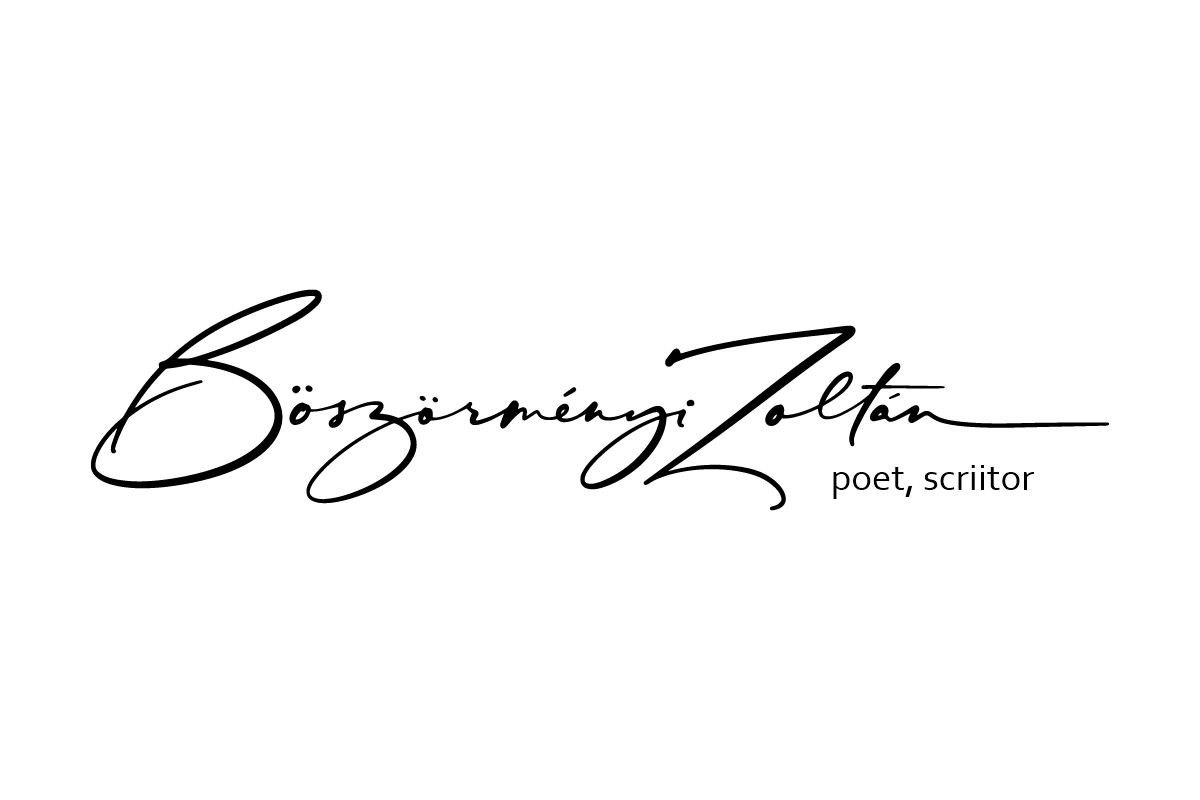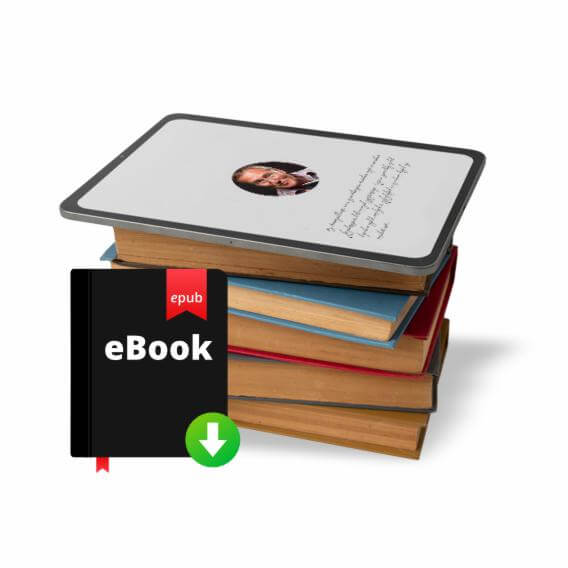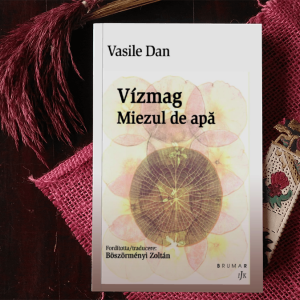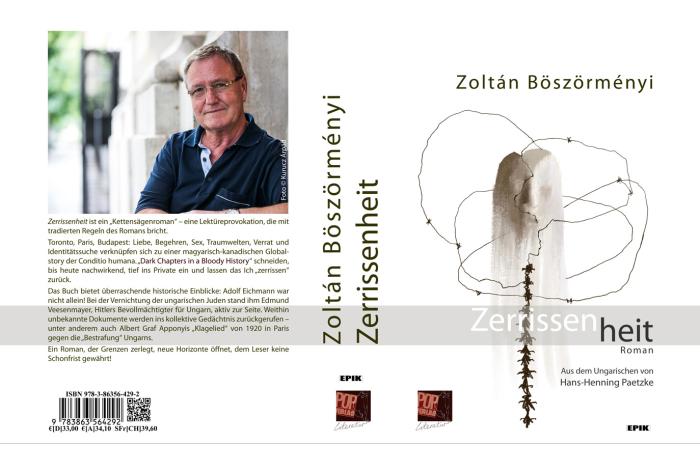
Zoltán Böszörményi: Zerrissenheit. Roman
Aus dem Ungarischen übertragen von Hans-Henning Paetzke
Pop Verlag, Ludwigsburg, 2026, ISBN 978-3-86356-429-2
Ein Mediensteckbrief
1 Zoltán Böszörményi – Profil des Autors
Zoltán Böszörményi wurde 1951 in Rumänien im siebenbürgischen Arad geboren. Er ist der Phänotyp des mehrsprachigen Ostmitteleuropäers, der alles Existenzielle dem Diktat des Ästhetischen unterwirft, für den sich Freiheit in der unauflösbaren Verflechtung zwischen Leben und Literatur manifestiert.
Zoltán Böszörményi ist einer der außergewöhnlichsten Erzähler der ungarischen Gegenwartsliteratur. Er schreibt kraftvoll, präzise und zugleich poetisch. Er sprengt äußerst innovativ und souverän Genregrenzen und verbindet dokumentarische Genauigkeit mit tiefen philosophischen Reflexionen, ohne je den Blick für die unentrinnbare Menschlichkeit zu verlieren. Sein Werk ist die Chronik einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte. Es schildert die packende Odyssee der existenziellen Standortsuche und des philosophisch-literarischen Identitätsdiskurses.
Seine Lyrik- und Proswerke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Von 2021 bis 2025 war Zoltán Böszörményi Präsident des Ungarischen PEN-Clubs. Er ist Laureat zahlreicher Auszeichnungen, darunter des renommierten Attila-József-Literaturpreises (2012).
2 Wovon erzählt der Roman Zerrissenheit?
Zwischen Begehren, Traumwelten, Identitätssuche, Holocaust und Trianon – sein neuestes auf Deutsch erschienenes Prosawerk ist buchstäblich ein Roman der Zerrissenheiten. Die atemlose Erzählung ist ein Mosaik aus privaten Verstrickungen und historischen Traumata. Die Handlung spielt an unterschiedlichen Orten – Toronto als Zentrum der bürgerlichen und intellektuellen Lebenswelten, Paris als Bühne für Vexierspiele und Täuschungen, Budapest als Erinnerungs- und Konfliktraum der ungarischen Vergangenheit und Gegenwart. Liebe, Begehren, Sex, Verrat und Identitätssuche verknüpfen sich zu einer magyarisch-kanadischen Globalstory der Conditio humana. Dokumentarische Einschübe – die „Dark Chapters in a Bloody History“ – schneiden tief ins Private ein und lassen das Ich unter historischen Schocks verstört zurück.
Im Mittelpunkt steht Melanie V. Templeton, eine kanadische Psychologin, deren Ehe mit dem Rechtsanwalt Richard Vaughn von Kälte und Distanz geprägt ist. Während Richard sich in Abenteuer und Spott flüchtet – er hat ein Verhältnis mit der Studentin Susan (Susi) Lang –, sucht Melanie Bestätigung in Affären: mit dem gehemmt-intellektuellen Paul Harding, Professor für Philosophie, und mit dem obsessiven Studenten Kenneth (Kenny) White. Dieser wiederum ist eng mit dem Informatiker Fredy Bloom – der Bezug zu Leopold Bloom aus dem Roman Ulysses von James Joyce ist offensichtlich – verbunden, mit dem er selbst in sexuellen Eskapaden eine fast symbiotische Freundschaft pflegt. Ihre gemeinsame Parisreise wird zum Inbegriff eines Vexierspiels der Extraklasse , in dem Traumwirklichkeiten die schnöde Realität aus den Angeln heben und die üblichen Wahrnehmungsmuster zum Kippen bringen.Parallel dazu erschließt das Figurenpaar Thomas Larringen, ein kanadischer Schriftsteller, und seine ungarischstämmige Ehefrau, die Immobilienmaklerin Eva Larringen, weitere Tiefendimensionen der Handlung. Thomas leidet an der Bedeutungslosigkeit der Literatur und unter Schreibblockaden, schafft aber schließlich mit einem Roman den fulminanten Durchbruch. Eva ist sehr erfolgreich, was sich in klingender Münze bemerkbar macht, und meistert das Leben pragmatisch. Sie ist über ihre todkranke Freundin Margit und deren ausführliche Briefe aus der alten Heimat ins traumatische Kollektivgedächtnis Ungarns eingeklinkt. Aber über Margit werden auch interessante Innen- und Außenansichten der politischen und kulturellen Verhältnisse im heutigen Ungarn sichtbar.
Eine weitere auf Empirie fokussierte Handlungsauffächerung erfährt der Roman durch die Gestalt Susis. Susan Lang ist Studentin und Freundin von George Banner, dem fest in der Realität verankerten Wohnungsvermieter und ehemaligen Driller auf einer Bohrinsel. Sie hat daneben auch eine Affäre mit Richard Vaughn, die Melanie nicht verborgen bleibt. Später tritt Susi – zutiefst traumatisiert von einer Gruppenvergewaltigung, die sie, von Scham und Selbstekel zerfressen, als lustvoll empfunden hat – als Patientin in Melanies Praxis auf. Damit entsteht eine beklemmende Konstellation: Melanie weiß, dass die junge Frau mit ihrem Mann geschlafen hat, muss ihr aber zugleich als Therapeutin begegnen.
Die Zerrissenheit der Figuren spiegelt sich auf einer zweiten Ebene in historischen Katastrophen. Ungarn nach 1920 – durch Trianon von jeweils zwei Dritteln seines Territoriums und seiner Bevölkerung beraubt – erscheint als amputierter Staat und traumatisierte Nation, deren anhaltender Schwebezustand zwischen analytischer Couch und Pathologie in der berühmten Pariser Erwiderung des Grafen Albert Apponyi auf Trianon (1920) anschaulich wiedergegeben wird – ein emotional nachhallendes „Klagelied“ gegen den asymmetrischen Vertrag der Siegermächte mit Ungarn.
Dazu montiert der Roman weitere Extreme aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Mit einigem Erstaunen kann der Leser erfahren, dass Adolf Eichmann in Ungarn nicht allein gewütet hat. Bei der Vernichtung der ungarischen Juden stand ihm Edmund Veesenmayer, Hitlers Bevollmächtigter des „Großdeutschen Reichs“ für Ungarn, aktiv zur Seite. Einer breiteren Öffentlichkeit und selbst unter Historikern weithin unbekannte Dokumente über das Wirken des SS-Brigadeführers (Generalmajor) Edmund Veesenmayers werden ins kollektive Gedächtnis zurückgerufen. Der Übersetzer Hans-Henning Paetzke hat die brisanten deutschen Originaldokumente aus US-amerikanischen Militärarchiven beschafft und es vermieden, die in der ungarischen Erstveröffentlichung verwendeten englischen Dokumente ins Deutsche zurückzuübersetzen.
Breiten Raum widmet der Roman auch dem mexikanischen Drogenbaron Joaquín (El Chapo) Guzmán, ein Symbol des globalisierten Bösen. Durch das fiktive Zusammentreffen des kriminellen Superhirns mit Gestalten wie Dante Alighieri, dem Heiligen Augustinus von Hippo und Voltaire entstehen alternative Traumwelten im spektakulären Konfliktfeld zwischen transnational agierendem Verbrechersyndikat und christlich-aufklärerischer Ethik.
3 Die narrative Architektur des Romans
Das Was ist wichtig, bekanntlich ist aber in literarischen Fragen das Wie entscheidend! Der Schriftsteller Thomas Larringen, eine der Hauptfiguren des Romans und teilweise ein Alter Ego des Autors, umreißt eine für das Buch charakteristische Poetik der Leidenschaft und Bedingungslosigkeit: „Schreiben (…), das ist Ekstase, Verzweiflung, kühner Flug der Gedanken, Feuer und Leidenschaft, metaphysisches Vibrieren, Häresie, Ablehnung der Wirklichkeit, Reise in die Tiefe der Hölle, der Wille, Spannungen zu schaffen, Qualen und Leiden …“ (S. 205)
Und in der Tat: In diesem Roman überschreitet die „Ekstase“ des Erzählers Kontinent- und Genregrenzen, seine „Verzweiflung“ lässt ihn mit der Geschichte abrechnen, „der kühne Flug der Gedanken“ vereint transzendente Mystik und exakte Wissenschaft, „Feuer und Leidenschaft“ nähern sich zärtlich und verständnisvoll dem zutiefst Menschlichen, „metaphysisches Vibrieren“ und „Ablehnung der Wirklichkeit“ gebären Traumwelten und Vexierspiele, seine „Reise in die Tiefe der Hölle“ ist eine Erkundung des Bösen, „Qualen und Leiden“ begleiten das Leben, aber auch den Schreibakt …
Ecce narrator! – Hier ist er, der Erzähler, im vollen Rampenlicht!
Es ist ein Erzähler, für den der Infrarealismus (Infrarrealismo) seines Referenzautors Roberto Bolaño Inspirationsquelle ist: raue Unmittelbarkeit, antikanonischer Formbruch, Primat des existenziell Nackten vor dem glatt Literarischen.
Für Zoltán Böszörményi ist Literatur kein geschlossenes System, sondern ein zerrissenes Gewebe von Fragmenten und Stimmen. In der Fragmenthaftigkeit spiegelt sich die menschliche Existenz, die von Brüchen, Verlusten und Widersprüchen geprägt ist. Gerade in ihrer Unvollständigkeit wird Literatur für ihn zum Medium, das Wahrheit schürfen kann.
Die Erzählperspektive Zoltán Böszörményis ist überwiegend neutral szenisch im Wechsel mit der personalen Innenperspektive. Vereinzelt setzt er aber auch auf die kommentierende auktoriale Perspektive und die Subjektivität der Ich-Erzählung. Dadurch erzeugt er eine Polyphonie, die von der kaleidoskopartig vielschichtigen und facettenreichen Wirklichkeitsreflexion förmlich erzwungen wird.
Entsprechend facettenreich ist der situativ eingesetzte Mix an Erzählverfahren. Der Text bevorzugt die szenische Darstellung und dialogische Polyphonie. Die Erzählinstanz tritt unaufgeregt in den Hintergrund und verzichtet bewusst auf autoritative Deutung. Die Dialogdominanz verlagert die Erkenntnis vom Erzählerkommentar in die Interaktion.
Aber auch zahlreiche innere Monologe (z. B. intensiv: Melanie) geben nackte subjektive Sichtweisen preis, so wie Binnenerzählungen (Das Los, 184 ff.; Der Bankrott, 247 ff.) den Erzählraum erheblich erweitern. Dokumentarische Einsprengsel und Medienmontage (sogenannte Archivästhetik: Briefe, Zeitungsartikel, Tagebucheinträge, historische Dokumente und Bilder) skalieren die Authentizität erheblich und überlassen die Wahrheitsfindung und Urteilsbildung fast kommentarlos den Lesern. Die zahlreichen Tagebuchreflexionen des Schriftstellers Thomas Larringen drücken im Übrigen dem Roman deutlich den Stempel des selbstkommentierten Erzählens auf.
Welt ist Text, Realität ist Text, Leben ist Text, Bewusstsein ist Text, Literatur ist Text: ALLES ist Text und ohne Text ist alles nichts! Das ist das Credo Zoltán Böszörményis. Und ein Text steht niemals allein: Er ist stets Teil eines weit verzweigten Netzwerks von anderen Texten – ohne Anfang und ohne Ende. Die „rhizomische Erzählarchitektur“ (Deleuze/Guattari) macht sich nicht nur in der nicht-hierarchischen Montage fiktionaler und nonfiktionaler Texte bemerkbar, sondern gipfelt in einer Fülle intertextueller Bezüge von Stimmen aus Geschichte, Philosophie, Wissenschaft und Dichtung, die im Romanganzen zusammenklingen. Der Erzähler spricht niemals nur mit einer einzelnen Stimme, sondern immer im Dialog mit anderen Texten und Elementen fraktaler Selbstähnlichkeit. In dieser Vielstimmigkeit treten über 40 Figuren von Epikur bis zum Heiligen Augustinus, von Kant bis Wittgenstein, von Goethe bis Bolaño, von Newton bis Hawking, von Albert Graf Apponyi bis Edmund Veesenmayer auf. Diese Polyphonie ist keine Schwäche der Ausuferung, sondern die Stärke der fokussierten Simultaneität: Sie zeigt, dass Welterkenntnis nur in der Vielheit der Stimmen möglich ist. Die intertextuellen Stimmen sind die glaubhaften Gewährsleute der erzählerischen Wahrhaftigkeit.
Hybridnarration, Genresprengung, Polytextur, Registerverschaltung – es entsteht eine polyphone, offene Architektur, die keinem stabilen Regelwerk folgen muss, sondern Erkenntnis aus dem Verfahren selbst gewinnt. Diese narrative Architektur verzichtet auf ein konsistentes Regelregime zugunsten kotextuell motivierter Verfahren. Der Roman fußt auf einer Poetik der Vielstimmigkeit, in der die ästhetische Codierung als zerrissen, polyphon, erinnernd und erkenntnisstiftend erscheint. Der Roman ist somit ein Raum, in dem individuelle und kollektive Erfahrungen, historische Traumata und philosophische Reflexionen ineinanderfließen, ohne je geglättet zu werden. Das ist die Grundidee des gesamten Werkes: Literatur als polyphones Projekt, das in seiner Zerrissenheit seine tiefste Wahrheit findet. Zerrissenheit ist die archetypische Chiffre des postmodernen Ichs – ein immerwährender Taumel zwischen rastloser Spiritualität, entgrenzten Begierden, fragilen Traumwelten, wissenschaftlichen Gewissheiten und geschichtlichen Katastrophen.
Walter Fromm
Pop Verlag, im Oktober 2025